VISION
Warum wir Bildung neu denken
Unser Bildungssystem steht an einem Scheideweg. Während sich die Welt in rasantem Tempo verändert – durch die Folgen des Klimawandels, die Digitalisierung, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, geopolitische Spannungen und gesellschaftliche Krisen – verharrt das deutsche Bildungssystem in alten Strukturen. Statt jungen Menschen Orientierung und Hoffnung zu geben, konfrontiert es sie mit Zukunftsängsten, Perspektivlosigkeit und Ungleichheiten.
Mit der Generation Z ist seit langem wieder eine Generation aufgewachsen, die sich nicht auf die Zukunft freut. Eine Generation, der die Hoffnung genommen wurde, dass „es in Zukunft einmal besser wird“. Und auch die Generation Alpha wächst mit denselben Ängsten auf. Sie wachsen mit dem Gefühl auf, von der Politik und von Institutionen nicht ernst genommen zu werden. Sie haben in der Corona-Pandemie ihre Jugend geopfert, um das Gesundheitssystem zu schützen, erleben marode Schulen, fehlende Lehrkräfte, überfüllte Kitas und müssen in Containern lernen – Nur, weil die Politik nicht gewillt ist, ausreichend Geld in die Hand zu nehmen und dem Bildungssystem die nötige Priorität einzuräumen. Gleichzeitig tragen sie die Last der Zukunft: Sie sollen die Renten stemmen, in einer unsicheren Welt bestehen und womöglich sogar in Kriege ziehen – ohne jemals das Vertrauen gewonnen zu haben, dass Politik und Gesellschaft ihre Interessen im Blick haben. Dieses Missverhältnis spaltet die Generationen: Während kurzfristige Entscheidungen auf dem Rücken junger Menschen getroffen werden, bleibt eine langfristige Vision für eine gerechte und nachhaltige Zukunft aus.
Wichtig hierbei zu verstehen ist, dass es sich um kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem handelt. Wir wissen längst, dass wir ein Bildungssystem brauchen, welches Menschen befähigt, die Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft zu lösen. Wir wissen, dass es mehr Gerechtigkeit, mehr Flexibilität und mehr Miteinander braucht. Und wir wissen auch, dass Bildung der Schlüssel für die Lösung der großen Fragen unserer Zeit ist – von der Klimakrise über den gesellschaftlichen Zusammenhalt bis zur Zukunft unserer Demokratie. Was uns fehlt, ist die gemeinsame Vision, das Verantwortungsbewusstsein und der Mut, Bildung so zu gestalten, dass sie Hoffnung gibt und eine Perspektive für die Zukunft schafft. Der Mut gemeinsam neue Wege zu gehen.
Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussehen wird, und können sie aufgrund des rasanten Wandels unserer Welt auch kaum voraussehen. Umso wichtiger ist es, kommenden Generationen einen Werkzeugkoffer an Schlüsselkompetenzen an die Hand zu geben.
Es ist an der Zeit, gemeinsam über das Bestehende hinauszudenken und eine neue Realität zu gestalten – eine Realität, in der Bildung nicht begrenzt, sondern entfaltet. Eine Realität, in der Bildungseinrichtungen zum Dreh- und Angelpunkt einer jeden Kommune und Stadt werden – mit modernen Gebäuden, die hervorragend ausgestattet sind und als zentrale Anlaufstelle für Kultur, Innovation und Gemeinschaft dienen. Eine Realität, in der Bildungseinrichtungen das Spiegelbild einer Wissensgesellschaft sind, deren Wohlstand auf Ideen, Innovation und Wissen gründet.
Wenn Kinder lernen, wie man lernt, und dabei erfahren, dass Lernen Freude bereiten kann; wenn sie entdecken, welche Fähigkeiten, Talente und Interessen in ihnen stecken, und Vertrauen in ihre eigenen Stärken entwickeln; wenn sie verstehen, ihr Handeln kritisch zu reflektieren, neugierig zu bleiben und Fehler als Teil des Lernprozesses zu begreifen – dann wachsen sie zu mündigen, selbstbewussten jungen Menschen heran. Solche jungen Menschen sind in der Lage, sich in einer zunehmend komplexen Welt zurechtzufinden und zukünftige Herausforderungen eigenständig, verantwortungsvoll und kreativ zu meistern.
Unsere Bildungseinrichtungen müssen ein Raum der Neugierde, der freien Entfaltung und der persönlichen Entwicklung sein. Ein Ort, an dem Menschen und Generationen zusammenkommen, sich austauschen, diskutieren und voneinander lernen. Ein Zentrum des lebenslangen Lernens, tief verwurzelt in den Werten von Demokratie und Solidarität. Ein Ort, der Respekt, Vielfalt und Integration nicht nur lehrt, sondern lebt. Bildungseinrichtungen sollten Orte sein, die dazu einladen, Ideen zu spinnen, gesellschaftliche Themen zu hinterfragen und sich inspirieren zu lassen. Bildungsstätten müssen Symbole der Gleichberechtigung und Gerechtigkeit sein – Räume, in denen jeder Mensch die Möglichkeit hat, sein volles Potenzial zu entfalten.
Es muss unser aller Ziel sein, den gesellschaftlichen Stellenwert von Bildung so auszurichten, dass Bildung zu einem grundlegenden Anliegen von uns allen wird. Jeder Mensch soll die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben sich selbst zu verwirklichen und das eigene Leben nach den individuellen Vorstellungen zu gestalten – frei von äußeren Zwängen und vorgegebenen Bahnen.
Bildung ist Zukunft! Was es braucht, ist ein Richtungswechsel, einen Wendepunkt in der Bildung, einen Wendepunkt in Richtung Zukunft!
DIE IDEE
Vom Problem zur Umsetzung
Um unserer Vision einer gerechten und zukunftsfähigen Bildungslandschaft ein Stück näher zu kommen, verfolgt unser gemeinnütziger Verein Wendepunkt Bildung e.V. drei zentrale Ziele:
- Systemische Veränderungen im Bildungssystem,
- Förderung demokratischer Teilhabe und gesellschaftlichen Austauschs,
- Schaffung von Transparenz und freiem Zugang zu Wissen.
Für die Umsetzung setzen wir auf zwei miteinander verzahnte Strategien: Einerseits initiieren und moderieren wir Bürgerbeteiligungsprozesse, die auf ganzheitliche, umsetzungsorientierte Lösungen zielen und demokratische Teilhabe fördern. Andererseits bauen wir eine kooperative Community auf, die durch Wissensaustausch, Transparenz und gleichberechtigte Mitbestimmung diesen Prozess begleitet und stärkt.
Innerhalb der Beteiligungsprozesse arbeitet eine interdisziplinäre Gruppe daran, aktuelle Herausforderungen im Bildungssystem zu analysieren, ihre Ursachen zu verstehen und darauf aufbauend tragfähige Lösungen zu entwickeln und praktisch umzusetzen. Es geht dabei nicht darum, Symptome zu bekämpfen, sondern die eigentlichen Ursachen zu adressieren. Zentral ist, dass dabei nicht alles neu entwickelt werden muss. Vielmehr bringen wir bereits bestehende Ideen, Projekte und Lösungsansätze in den gemeinsamen Diskurs, prüfen deren Wirksamkeit und planen, wie sie in die Praxis überführt oder weiterentwickelt werden können. So entsteht ein Raum für Austausch, Kooperation und gemeinsames Lernen – das Rad muss nicht neu erfunden werden, sondern wir bringen vorhandenes Wissen in Bewegung.
Die Umsetzung wird durch einen kontinuierlichen Evaluationsprozess bis zur vollständigen Implementierung, begleitet. Wird erkennbar, dass eine Lösung nicht greift oder keine Anwendung findet, wird der Prozess erneut aufgerollt, bis eine tragfähige und anschlussfähige Lösung gefunden wurde. Unser Fokus liegt klar auf Handeln statt Verwalten – es geht darum, wirklich in die Umsetzung zu kommen.
Bürgerbeteiligung ist an sich nichts Neues. Doch unsere Herangehensweise unterscheidet sich in fünf zentralen Punkten zu staatlich organisierten Prozessen:
- in der Zusammensetzung der Gruppe,
- in der Liveübertragung der Prozesse,
- in der Möglichkeit der Echtzeitbeteiligung über Website und App,
- in einem Rahmen, der auf Design- und System Thinking basiert,
- sowie im konsequenten Fokus auf Ursachenanalyse und Umsetzung.
Um den komplexen Herausforderungen des Bildungssystems gezielt und wirksam begegnen zu können, organisieren wir unsere Bürgerbeteiligungsprozesse entlang klar definierter Themenschwerpunkte:

Jeder Beteiligungsprozess widmet sich daher einem dieser spezifischen Schwerpunkte, zu dem wir gezielt Expert:innen, betroffene Akteur:innen und Entscheidungsträger:innen einladen. Gleichzeitig behalten wir stets den ganzheitlichen Blick auf das Gesamtsystem bei. Daher werden Wechselwirkungen zwischen den Themenfeldern bewusst mitgedacht, um nachhaltige, systemisch anschlussfähige Lösungen zu entwickeln. So vermeiden wir, dass die Prozesse zu groß und unübersichtlich werden, und schaffen stattdessen konzentrierte Räume, in denen Fachwissen, Erfahrung und Perspektiven sinnvoll zusammengeführt werden.
Ergänzend zu den Bürgerbeteiligungsprozessen spielt unsere Community-Plattform eine zentrale Rolle. Sie macht Prozesse und Ergebnisse transparent, nachvollziehbar und ermöglicht gleichzeitig den Austausch von Wissen, Erfahrungen und Expertise. Langfristig wollen wir durch das Organisieren von Events, wie beispielsweise von Podiumsdiskussionen, Bildung weiter in den zentralen öffentlichen Diskurs bringen. Außerdem soll die Plattform zudem Studierenden und Nachwuchsforscher:innen die Möglichkeit bieten, ihre im Bildungsbereich entstandenen Arbeiten, wie Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und Paper, kostenlos zu veröffentlichen. So wird wertvolle wissenschaftliche und praktische Arbeit sichtbar, zugänglich und nutzbar gemacht.
Damit die Abläufe greifbar werden, skizzieren wir im Folgenden, wie die Prozessstruktur exemplarisch aussehen kann. Dieser Ablauf dient als Beispiel für unser Pilotprojekt. Zunächst testen wir im kleinen Rahmen, ob der Prozess wie vorgesehen funktioniert. Langfristig wollen wir die Bürgerbeteiligung skalieren und auf immer größere Zielgruppen ausweiten.
Ablauf Bürgerbeteiligungsprozess
Anfrage & Erstgespräch
Städte und Kommunen werden von uns kontaktiert und zu Erstgesprächen eingeladen in denen Ideen, Planungszeiträume und Budgets besprochen werden. Hier setzen wir auch fest, zu welchem Themenschwerpunkt wir den Prozess initiieren wollen. Gleichzeitig wird eine erste Gruppe für den Prozess zusammengestellt. Dabei bestehen die Teilnehmenden aus:
- Entscheidungsträger:innen: (Stadtteilverein, Quartiersmanagement),
- Engagierte Akteure: (Stiftungen, Schulen, Universitäten, Jugendhilfe, Förderprogramme),
- Zivilgesellschaft: (Bewohner:innen des Stadtteils),
- Junge Generationen: (Schüler:innen, Studierende und Auszubildende),
- Expert:innen: (Professor:innen, Fachberater:innen).
Gemeinsam mit der Kommune laden wir anschließend zur Auftaktveranstaltung ein.
Phase 1: Onboarding & Problemidentifikation
In diesem ersten Treffen erfolgt zunächst eine Einführung in Design-Thinking-Methoden und dem Ablauf. Abschließend lernen die Teilnehmenden einander kennen und tauschen sich aus. Dieser Teil wird nicht live übertragen, da die Teilnehmenden ersteinmal ankommen und sich wohlfühlen sollen.
In den folgenden Treffen – die nun live gestreamt werden – steigen die Teilnehmenden gemeinsam in die thematische Arbeit ein. Sie erarbeiten zentrale, sich überschneidende lokale Herausforderungen, ordnen diese in den landesweiten Kontext ein und analysieren ihre Ursachen. Dabei werden Kernprobleme identifiziert, priorisiert und in ihren Systemzusammenhängen verstanden, um gezielt Lösungsansätze zu entwickeln. Parallel dazu formulieren wir eine klare Zukunftsvision für eine Problemwelt, in der diese Hürden nicht mehr existieren.
Beispielsweise könnte sich herausstellen, dass fehlende Nachmittagsbetreuung, Sprachbarrieren und psychische Belastungen zentrale Ursachen für ein lokales Problem sind. Parallel ergibt die Analyse, dass ähnliche Probleme auch in anderen Städten bestehen. Daraus entwickeln sie das Zielbild: Ein Stadtteil, in dem alle Kinder erfolgreich ihren Abschluss schaffen und individuelle Unterstützung erhalten.
Phase 2: Lösungsentwicklung & Umsetzungsstrategien
In systematischen Co-Creation- und Brainstorming-Sessions tragen die Beteiligten zunächst Beobachtungen, Interviews und Erfahrungsberichte zusammen, um eine umfassende Analyse der bestehenden Probleme im Themenschwerpunkt durchzuführen. Auf dieser Basis entwickeln sie in einer Ideation-Phase kreative, ganzheitliche Lösungskonzepte für die priorisierten Kernprobleme. Bereits existierende Ansätze und erfolgreiche Konzepte werden dabei integriert, um Synergien zu nutzen und Doppelarbeit zu vermeiden. Die vielversprechendsten Lösungsansätze werden anschließend anhand von Machbarkeit und Wirkung priorisiert und in konkrete Handlungsschritte und Umsetzungsstrategien überführt.
So könnte hier die Beteiligungsgruppe mehrere Ideen entwickeln wie: ein Patenschaftsprogramm mit Studierenden, niedrigschwellige Beratungsangebote an Schulen oder mehrsprachige Elternabende. Auch über die Community-Plattform werden weitere Anregungen eingebracht. Am Ende wird ein Maßnahmenpaket geschnürt, das als Pilotprojekt in zwei Schulen starten soll. Der Beschluss wird online über die Plattform per einfacherer Mehrheit gefasst.
Phase 3: Prototyping & Testläufe
Wir begleiten die Umsetzung kleiner, greifbarer Prototypen – etwa in Form von Pilot-Workshops, digitalen Tools oder neuen Abläufen – und erproben sie gemeinsam mit den Beteiligten im realen Umfeld. Durch kontinuierliche Beobachtung, gezieltes Feedback und Evaluation wird analysiert, wie die Lösungen in der Praxis wirken und wo Anpassungen erforderlich sind. Der Entwicklungsprozess wird dabei laufend feinjustiert, wobei die Evaluationsmetriken passgenau an die jeweilige Lösung und ihre spezifischen Ziele angepasst werden.
Basierend auf dem Maßnahmenpaket, wird nun ein mehrsprachiger Elternabend mit Community-Dolmetscher:innen an einer Schule getestet. Die Rückmeldungen zeigen: Gute Annahme, aber Bedarf nach Kinderbetreuung parallel zur Veranstaltung. Das Feedback fließt direkt in die nächste Version des Formats ein.
Phase 4: Skalierung & Verstetigung
Erfolgreiche Prototypen werden auf weitere Stadtteile oder das gesamte Kommunalgebiet schrittweise ausgerollt. Anschließend weiter auf Landes- und anschließend auf Bundesebene. Eine nachhaltige Begleitung sowie die langfristige Verankerung im Bildungssystem sichern den Erfolg der entwickelten Lösungen. Aus diesen Prozessen bilden sich innerhalb unserer Organisation Arbeitsgruppen, die laufende Prozesse und die Skalierung der entwickelten Prototypen bzw. Umsetzungsstrategien in ihrem Themengebiet im Auge behalten. Außerdem definieren wir Verantwortlichkeiten, Ressourcen und Meilensteine, damit die entwickelten Maßnahmen dauerhaft im System verankert werden.
Schlussendlich wird die erfolgreiche Idee auf weitere Schulen im Stadtteil ausgeweitet. Die Stadt sichert über den Haushalt Mittel zur dauerhaften Umsetzung, parallel wird ein Antrag auf Landesförderung gestellt.
DAS TEAM
Die Köpfe hinter dem Projekt
Wir sind Denise und Philipp – zwei Menschen, die sich schon länger kennen und gemeinsam daran arbeiten, Bildung neu zu denken. Was uns verbindet, ist der Wunsch, das Bildungssystem gerechter, partizipativer und zukunftsfähiger zu gestalten. Wir glauben daran, dass echte Veränderung nur dann entsteht, wenn Menschen die Möglichkeit bekommen, sie mitzugestalten!
Denise ist bei uns für die Konzeption und Leitung der Bürgerbeteiligungsprozesse verantwortlich. Durch ihre Arbeit im Bildungsbereich und einem Studium in Global Project and Change-Management, bringt sie viel Erfahrung in der Gestaltung und Konzeptionierung von Workshops mit.
Philipp hat das Projekt vor drei Jahren ins Leben gerufen und kümmert sich heute um Finanzen, rechtliche Strukturen und das Management des Vereins. Neben seinem Studium der Bildungswissenschaften arbeitet er bei einem außerschulischen Bildungsträger, der sich für Orientierung und Talentförderung einsetzt, und engagiert sich als ehrenamtlicher Jugendleiter. Außerdem bringt er Erfahrung aus Projektleitung und Gründung mit.
Wir treffen Entscheidungen im Konsens, arbeiten in flachen Hierarchien und verstehen uns als lernendes Team, das immer wieder hinterfragt, ausprobiert und verbessert. Unsere Arbeit basiert auf Werten wie sozialem Bewusstsein, Gleichberechtigung, Transparenz, Nachhaltigkeit und einer offenen, respektvollen Kommunikationskultur.
Unser Ziel ist es, Bildung nicht nur zu reformieren, sondern gemeinsam mit allen Beteiligten weiterzudenken – demokratisch legitimiert, inklusiv und langfristig wirksam.
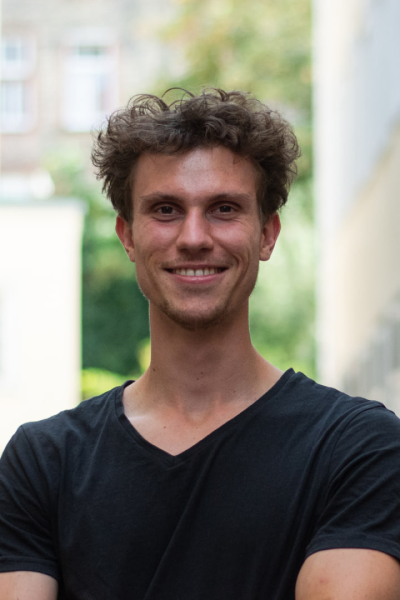

ROADMAP
Unsere nächsten Schritte
Obgleich wir bislang keine Pilotprojekte durchgeführt haben, planen wir erste, lokal begrenzte Testläufe in Heidelberg und Mannheim. Parallel dazu stehen für die nächsten 12–18 Monate auf unserer Roadmap: Gründung der Organisation (gemeinnütziger Verein), der systematische Ausbau unseres Netzwerks und die Initiierung eines ersten Pilotprojekts.
Bei unserem Vorgehen rechnen wir mit klassischen Systembarrieren: umfangreiche Bürokratie, starrer Denk- und Traditionsmuster, Angst vor Veränderung sowie Überforderung bei den Akteur:innen. Hinzu kommen finanzielle Engpässe und der Einfluss etablierter Lobbygruppen. Unsere systemische, kooperative Vorgehensweise ist jedoch genau darauf ausgelegt, diese Hürden durch gezielte Einbindung und Entlastung der Entscheidungsträger:innen zu überwinden.
Wir glauben, dass nachhaltiger Wandel nur entstehen kann, wenn alle relevanten Perspektiven zusammengebracht werden – und genau hier setzen wir an. Wir würden uns freuen, gemeinsam mit Ihnen einen ersten Piloten erfolgreich umzusetzen!
FINANZEN
Wie wir unsere Kosten decken
Unsere Einnahmen setzen wir gezielt ein, um den Verein nachhaltig zu betreiben. Die Mitgliedsbeiträge decken dabei die administrative Basisarbeit (ca. 10 % der Gesamteinnahmen) und sichern das reibungslose Funktionieren des Vereins. Der größte Teil unserer Kosten wird über Spenden, Crowdfunding und Fördermittel finanziert (etwa 70 %). Die verbleibenden 20 % stammen aus Kooperationen und Sponsoring. Als gemeinnützige Organisation fließen alle eingeworbenen Mittel primär in Personalkosten für die Koordination und Begleitung der Beteiligungsprozesse sowie in die Organisation von Veranstaltungen und die Bereitstellung von Materialien.
JOIN US!
Wir brauchen DICH!
Wir können Großes nur gemeinsam erreichen – und genau dafür brauchen wir DICH!
Ein so großes Projekt wie unseres kann nicht von wenigen allein gestemmt werden und das soll es auch nicht. Es sind Probleme, die uns alle betreffen und können nur im Miteinander gelöst werden. Deshalb sind wir auf deine Unterstützung angewiesen. Egal, ob du Schüler:in, Experte:in im Bereich Bildungs- und Sozialwissenschaften, Lehrer:in, Erzieher:in, Student:in, Aktivist:in, Teil einer Initiative, Stiftung, eines Vereins, einer Eltern- oder Schülervertretung, eines Thinktanks, einer Behörde oder einfach DU – weil dir das Thema am Herzen liegt – wir brauchen EUCH alle!
Werde Teil unseres Bündnis:
- Schließ dich unseren Themengruppen an und bringe deine Ideen ein.
- Unterstütze uns im Organisationsteam und gestalte die Zukunft aktiv mit.
- Oder unterstütze uns finanziell, mit deinem Fachwissen, im Marketing oder auf anderen Wegen.